Schweizer (Lokführer) in sechs Monaten
Eine Investition, die sich auszahlt
Wenn man in einem Land einen Zug fahren kann, heisst das noch lange nicht, dass man das auch in einem anderen kann. Die Vorschriften sind auch im Zeitalter der europäischen Einigung noch weitgehend national. Wer als deutscher Lokführer in die Schweiz will, muss ein weiteres Mal die Schulbank drücken. Der Kurs dauert sechs Monate, richtet sich explizit an fertig ausgebildete und erfahrene deutsche Lokführer und nennt sich „Netzzugang“. Durchgeführt wird er von der Firma MEV, damals noch in Basel, heute in Muttenz. Die Firma gehört wie 13 andere zur TEX (Trans Europa Express) Holding mit Sitz im schweizerischen Pfäffikon. Deren 14 Firmen sind in fünf Ländern (Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien und Niederlande) tätig und decken vier Geschäftszweige ab:
- Transportleistungen
- Beratung von Eisenbahnunternehmen
- Infrastruktur-Dienstleistungen
- Schulungen und Prüfungen
Einer der wichtigsten Kunden war railCare. Die sourct nicht nur die Ausbildung ihrer künftigen Lokführer an die MEV aus, sondern sogar die Personalauswahl. Meine Zusage für railCare erhielt ich, bevor ich überhaupt jemanden von der Firma kennengelernt hatte.
Die Ausbildung ist, wie alles in der Schweiz, nicht ganz billig. Die Gesamtkosten betrugen Fr. 60‘000 (64.000 €). Wer nicht französisch kann, darf zusätzlich einen zweiwöchigen Kurs zum Niveau A1+ absolvieren, der mit weiteren Fr. 2‘000 zu Buche schlägt. Das Plus steht für Eisenbahn-Fachausdrücke. Allerdings würde ich mich damit nicht in die Westschweiz wagen. In den Gesamtpreis eingeschlossen ist eine Ausbildungsvergütung, die bereits höher liegt als das volle Gehalt eines deutschen Lokführers. Trotzdem: Weil nicht jeder ein so fettes Sparschwein hat, läuft das normalerweise so ab, dass der künftige Arbeitgeber gegenüber der MEV in Vorleistung tritt und der Lokführer von seinem Lohn jeden Monat Fr. 1‘000 abbezahlt. Das heisst, nach fünf Jahren ist der Lokführer schuldenfrei. Falls er vorher die Stelle wechselt, muss er die noch offene Schuld entweder ablösen oder seinen neuen Arbeitgeber davon überzeugen, dies zu tun. In meinem Fall hatte railCare nichts mit der Finanzierung zu tun, sondern die MEV und ich einigten uns in einer Sitzung auf ein Modell, das die Bedürfnisse beider Seiten berücksichtigte. Dabei bewies MEV eine grosse Flexibilität und Kundenorientierung, die man bei staatlichen Eisenbahnen vergeblich suchen dürfte.
Grau ist alle Theorie
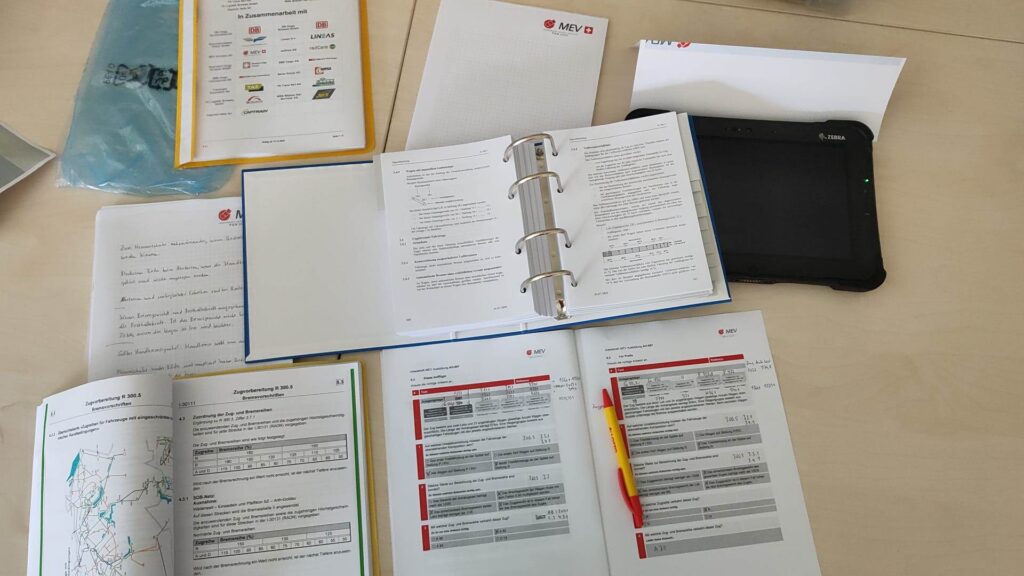
Als der nächste Kurs mit fünf Teilnehmern startete, konnte es endlich losgehen. Naturgemäss zunächst mit der Theorie. Die schweizerischen Fahrdienstvorschriften sind fast so umfangreich wie die deutschen. Da gibt es beispielswese Slalom- und Fluchtfahrten, Entfluchtung und Entpannung. Nein, da fehlt kein „s“. Zwischendrin gab es zwei Praxiswochen. Die fanden bei meinem zukünftigen Arbeitgeber an den beiden künftigen Einsatzorten statt: Wangen bei Olten im Kanton Solothurn und Schafisheim im Kanton Aargau. Am Ende des theoretischen Unterrichts stand die theoretische Führerscheinprüfung auf dem Programm. Sie bestand aus vier Teilen:
1. Allgemeine Fahrdienstvorschriften, harmonisierte Betriebsvorschriften, Ausführungsbestimmungen Infrastruktur und Betriebsvorschriften von railCare schriftlich.
2. European Train Control System (ETCS) schriftlich.
3. Dieselben Themen wie unter Punkt 1, aber mündlich.
4. ETCS mündlich.
Meine Ergebnisdurchschnitt war 91%. Keine Ahnung, wie sie das gerechnet haben, denn rein subjektiv hatte ich das Gefühl, zumindest in den schriftlichen Teilen jede zweite Frage falsch beantwortet zu haben. ETCS bedeutet im Wesentlichen Führerstandsignalisierung, d.h. an der Strecke sind gar keine Signale mehr aufgestellt. Das lässt sich am besten am Simulator üben.

Am Ende stand eine Überprüfungsfahrt. Ich bin durchgefallen! Ich hatte nicht richtig aufgepasst. Knapp drei Wochen später bekam ich zusammen mit einer anderen Ausbildungsgruppe eine Nachschulung. Diesmal habe ich auch die Überprüfungsfahrt bestanden. Mein einziger Schnitzer war, dass ich die offenen Schranken des Bahnübergangs sehr spät gesehen habe und eine Schnellbremsung hinlegen musste.
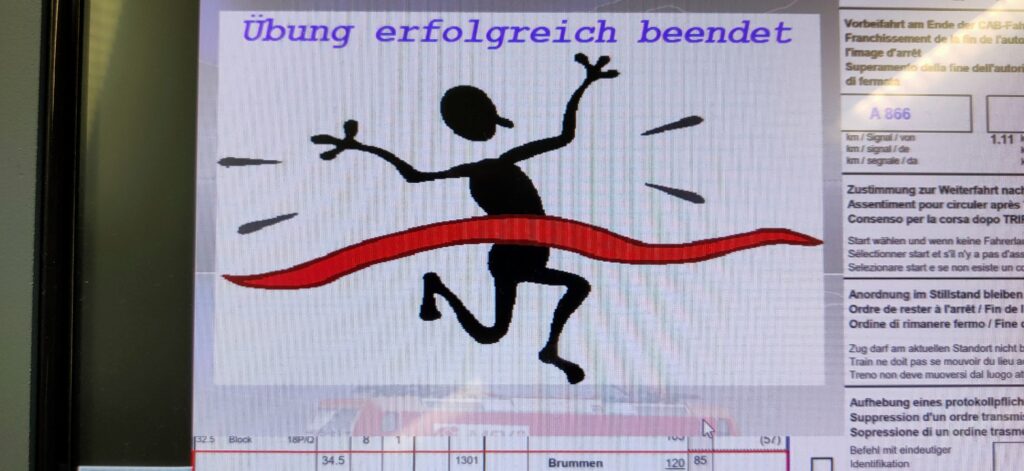
Nach der Theorie folgten noch Instruktionen für den Gotthard- (57 km) und den Lötschberg-Basistunnel (35 km) über die jeweiligen Betriebs-, Schutz- und Rettungskonzepte. MEV hat hochkarätige Fachleute an Bord, unter anderem einen der geistigen Väter des ETCS. Auch unsere Ausbilder zeichneten sich allesamt durch Engagement, Kompetenz, Professionalität und Sachverstand aus, und der Ausbildungsverantwortliche hatte jederzeit ein offenes Ohr für Anliegen und Probleme.
Für die Streckenkunde musste man jede Strecke samt Umleitungsstrecken in jeder Richtung mindestens viermal befahren, wenn möglich einmal bei Dunkelheit. Entweder selbst in Begleitung eines erfahrenen Kollegen oder als Mitfahrer im Führerstand, gerne auch bei den SBB. Da railCare fast durch die ganze Schweiz fährt, war das eine gewisse Herausforderung.
Ganz praktisch
Dann begann der praktische Teil der Ausbildung. Das heisst, ich durfte unter der Aufsicht erfahrener Kollegen entweder von MEV oder von railCare fahrplanmässige Züge selbst fahren. Allerdings wollte mein Ausbilder, dass ich die Lok selbst aufrüstete, bevor ich eine Fahrzeugschulung erhalten hatte. Überhaupt sollte ich schon am vierten Praxistag alles alleine können, und er hat protokolliert, was geklappt hat und was nicht. Er war recht zufrieden.
Eine meiner Ausbildungstouren führte nach Brig. Auf der Rückfahrt zusammen mit meinem Kollegen erhielt ich schon ein paar Kilometer nach der Abfahrt in Ausserberg ein grün-oranges Vorsignal (Fahrbegriff 2). Das bedeutet normalerweise, dass man ab dem ebenfalls grün-orangen Hauptsignal nur noch 40 km/h fahren darf. Zufällig fiel mein Blick auf meine Fahrordnung: Darin stand eine örtliche Besonderheit, nämlich, dass man in dem betreffenden Bahnhof in diesem Fall sogar mit höchstens 20 km/h und auf Sicht fahren musste, weil die Reisenden dort die Gleise überqueren könnten. Allerdings war kein Mensch weit und breit.
Wenig später sogar ein rotes Signal, was bergauf höchst ärgerlich war. Der Grund: Der Fahrdienstleiter diktierte mir einen schriftlichen Befehl. Das geschieht normalerweise so nah wie möglich an der betreffenden Stelle. Meiner galt aber erst 30 km weiter. Dort musste ich 500 m lang auf Sicht fahren. Grund: Tiere im Gleisbereich. Ich sah aber keine. Und die Stelle war für Tiere ohne Flügel auch nur sehr schwer zugänglich.
Das Einfahrsignal von Spiez, das sich in einem Tunnel befindet, war rot. Als ich schon fast stand, wies mich der Kollege auf den darunter leuchtenden schrägen orangen Strich hin: Es war ein Hilfssignal, das mir die Weiterfahrt auf Sicht mit höchstens 40 km/h erlaubte. Am Tunnelausgang hatte ich 20 km/h drauf. Er meinte, das sei immer noch zu schnell gewesen, weil ich nicht mehr hätte bremsen können, wenn ein Selbstmörder vor dem Tunnelportal die Gleise überquert hätte. Allerdings wäre der auf Sichtdistanz kaum zu erkennen geweisen.
Inzwischen hatten wir anderthalb Stunden Verspätung. Erst jetzt kam heraus, dass mein Kollege die drei Punkte allesamt beim Fahrdienstleiter bestellt hatte. Deshalb hatte er sich vor der Abfahrt nicht wie sonst über den Zugfunk, sondern von seinem Handy aus fahrbereit gemeldet, als er nicht auf der Lok war, damit ich nicht mithören konnte. Diese Zugfahrt werde ich so schnell nicht vergessen.

Natürlich gefiel mir nicht alles. Eine meiner Schichten endete um 21.30 Uhr. Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr begann bereits die nächste. Ich habe sofort reklamiert. Antwort: Gemäss schweizerischem Arbeitszeitgesetz (AZG) müsse der Übergang zwischen zwei Schichten „nur“ im Durchschnitt über vier Wochen 12 Stunden betragen. In Deutschland wäre das nicht erlaubt.

Gegen Ende der Ausbildung stand die „Feststellung der Prüfungsreife“ auf dem Programm. Zwei meiner Ausbilder fuhren mit. Sie kritisierten zwar dies und jenes, aber fanden, ich sei prüfungsreif. Zwei Tage später durfte ich zur praktischen Prüfung antreten. Ich war schon die ganze Woche über angespannt gewesen, hatte schlecht geschlafen und war so nervös wie selten vor einer Prüfung. Eine kleine Unachtsamkeit genügte, um durchzufallen. Ich hatte die sogenannte „Wassertour“, die so heisst, weil man in Brig Mineralwasser lädt. Als es losging, verwechselte ich ein Abschnitts- mit einem Ausfahrsignal. Beide hatten denselben Grünton und waren deshalb schwer zu unterscheiden. Dann piepte die Zugüberwachung, weil ich in Biel 30 m vor einem roten Signal noch 6 km/h draufhatte und sie dachte, ich würde darüber hinausschiessen. Der Tempomat war bei der Prüfung nicht zugelassen. Obwohl ich sicherheitshalber immer versuchte, 5 km/h unter der zulässigen Geschwindigkeit zu bleiben, hatte ich beim Bergabfahren übersehen, dass hinter Frutigen nur 80 km/h erlaubt waren, und merkte es erst bei 84 km/h. Trotzdem meinte der Prüfer zuletzt, er sei neben mir sehr entspannt gewesen, und meine Leistung sei „gut bis sehr gut“ gewesen. Deshalb stieg er auch bereits in Solothurn aus, und den Rest der Prüfungsfahrt nach Wangen machte ich allein mit meinem Chef. Damit endete mein Ausbildungsvertrag mit der MEV fahrplanmässig nach sechs Monaten, und ich war mächtig stolz, dass ich es geschafft hatte.
